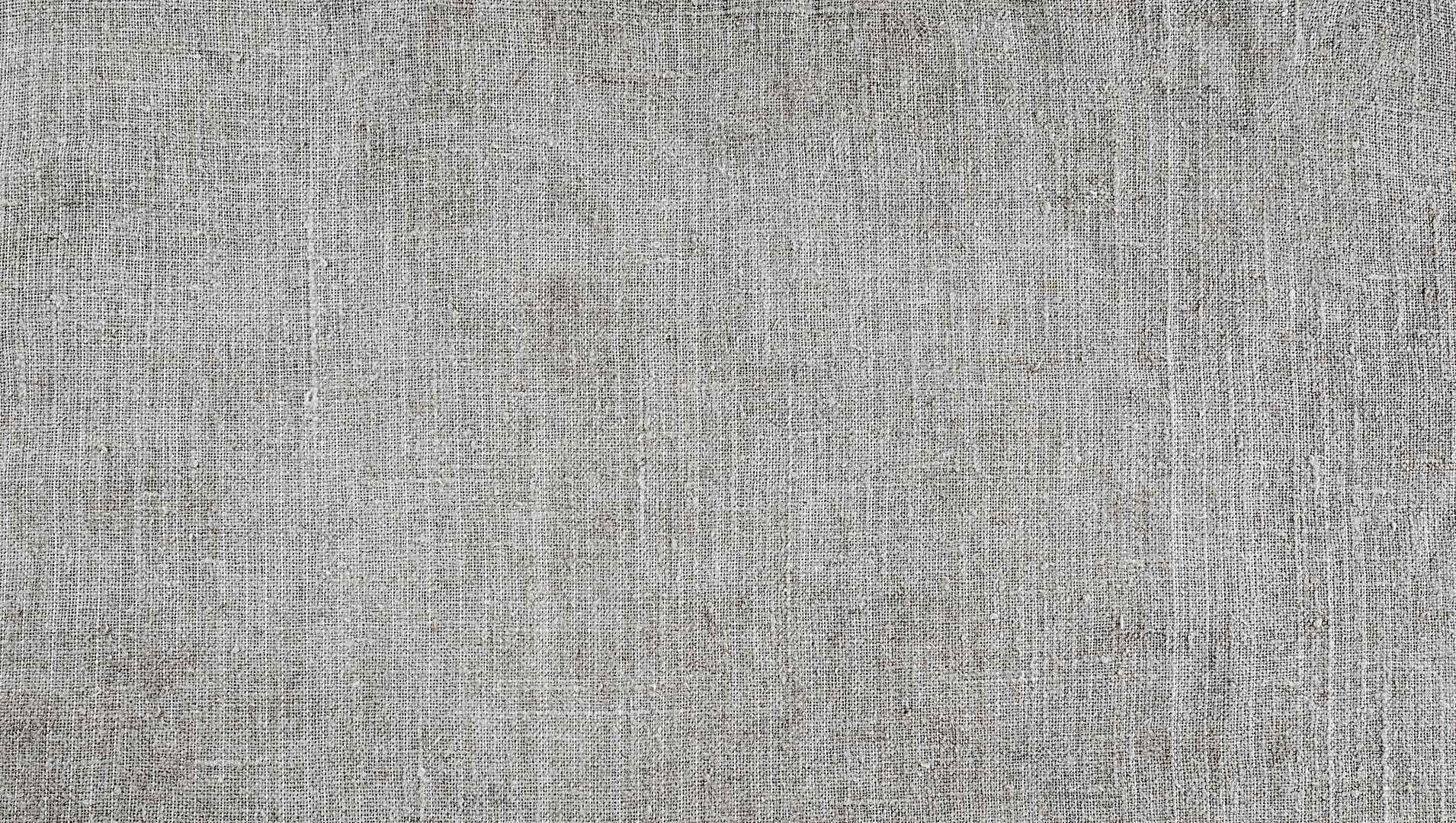Kaum eine Region in Deutschland bot eine derartige Vielfalt der Produktion von Fasern für Bekleidung, technische Zwecke und Papier wie die Prignitz und das Havelland. Außer den Tuchmacherstädten Pritzwalk und Wittstock mit ihren Werken gab es als Verarbeiter von Schafwolle auch eine Tuchfabrik in Wittenberge. Hanf und Flachs aus der Region verarbeiteten die Fabriken der Bastfaser GmbH in Fehrbellin und Rhinow sowie die Hanffabrik Bergerdamm bei Nauen. Die Papierfabrik in Hohenofen südlich von Neustadt (Dosse) nutzte Hadern, also Lumpen aus Hanf, Flachs und Baumwolle, als wichtigsten Rohstoff. Später verwendete die Papierfabrik Zellulose, also chemisch aufbereitete Pflanzenfasern. Zellulose war auch die Grundlage für die Produktion der Chemiefaserfabriken in Wittenberge und Premnitz. In Premnitz wurden dann synthetische Fasern hergestellt: Perlon (Dederon) genauso wie Grisuten oder Wolpryla.
Tuchindustrie in Pritzwalk, Wittstock und Wittenberge
Tuchmacher prägten die Region um die Städte Wittstock und Pritzwalk seit dem Spätmittelalter. So weideten um 1800 knapp 140 000 Schafe in der Prignitz und lieferten den Rohstoff für die Tuchmacher: die Wolle. 1826 gab es allein in Wittstock 275 Betriebe, welche sie verarbeiteten. Das Gewerbe profitierte von der Lage an der Dömnitz in Pritzwalk und an der Dosse in Wittstock. Denn die Wolle wurde mit Hilfe von viel Wasser gewaschen und gefärbt.
Doch die Industrialisierung veränderte die Branche radikal. Aus der Vielzahl der kleinen Handwerksbetriebe entstanden wenige Fabriken, allerdings mit sehr vielen Arbeitern und – etwa zur Hälfte – Arbeiterinnen. Übrig blieben in den 1880er Jahren in der Prignitz nur drei, noch als Manufakturen gegründete Unternehmen: die 1839 gegründete Tuchfabrik Gebrüder Draeger in Pritzwalk (1883 beschäftigte sie 70 Arbeiter) sowie die 1828 in Wittstock gegründete Tuchfabrik Friedrich Wilhelm Wegener und die 1845 ebenfalls dort gegründete Tuchfabrik von Friedrich Paul. Seit 1882 bildeten Draeger und das doppelt so große Wegener-Werk eine Einkaufs- und Vertriebsgemeinschaft. 1911 schlossen sich alle drei Betriebe zu einem Unternehmen zusammen: der Draeger-Paul-Wegener-Werke GmbH. Ausdruck ihrer Kraft sind die heutigen Fabrikbauten am Meyenburger Tor in Pritzwalk sowie am Rosenwinkel und am Walter-Schulz-Platz in Wittstock.
Allein in Pritzwalk beschäftigte Draeger zwischen den Weltkriegen mehr als 300 Menschen. Die Fabriken in Pritzwalk und Wittstock waren zudem die Grundlage für das große Vermögen der Industriellenfamilie um Günther und Werner Quandt. Sie hatte sich durch unternehmerische Fähigkeiten, beherzte Übernahmen und geschicktes Heiraten schon früh ein kleines Imperium aufbauen können. Der spätere Firmenpatriarch Emil Quandt (1849–1925) war im Alter von 16 Jahren bei der Firma Gebrüder Draeger in Pritzwalk eingestellt worden.
Nicht nur Technik und Abläufe hatten sich mit der Industrialisierung stark verändert, auch die Preise für Rohwolle fielen stark, weil Schafzüchter aus Australien, Neuseeland, Südafrika und Südamerika auf den Weltmarkt drängten. Deshalb importierten die Europäer immer mehr Wolle. Den Wollimport aus Übersee beschleunigte die Eisenbahn: 1885, als der Wollpreis besonders niedrig war, bekamen Pritzwalk und Wittstock einen Bahnanschluss. So gab es in den 1930er Jahren nur noch 10 000 Schafe in der Prignitz.
Schon früh hatten sich alle drei Betriebe auf die Produktion von Uniformtuchen vor allem für Behörden wie Heer, Marine, Eisenbahn, Post, Straßenbahn und Feuerwehr spezialisiert. Vor dem Ersten Weltkrieg gab es in Deutschland etwa 1 000 Tuchfabriken, mehr als 350 davon waren Uniformtuchfabriken. Dies bescherte den Werken in der Prignitz zu den Kriegen eine erhebliche Sonderkonjunktur. Doch in beiden Weltkriegen wurden Rohstoffe äußerst knapp, die Produktion schrumpfte und wurde zum Teil eingestellt. In beiden Weltkriegen wichen die Tuchfabriken deshalb auf Ersatzstoffe aus. So stieg der Anteil von Kunstwolle und anderen Surrogaten im Ersten Weltkrieg bis zum Frühjahr 1917 auf 70 Prozent.
Kunstwolle, auch Reißwolle genannt, waren Abfälle der wollverarbeitenden Industrie sowie getragene wollhaltige Gewebe (Lumpen). Die Kunstwollwerke in Scharfenberg südlich von Wittstock stellten die Kunstwolle für die Draeger-Paul-Wegener-Werke GmbH her. Wollreste wurden damals auch für die Herstellung von Pappen und Dünger verwendet. Spätestens 1917 wurde zudem in Pritzwalk der Einsatz von Torf als Wollersatz ausprobiert: Die Torffasern wurden dafür aufwendig gereinigt, belasteten aber die Maschinen und boten nur schlechte Garnqualität. Diese Episode kam deshalb aus dem Versuchsstadium kaum heraus. Im „Dritten Reich“, seit 1933, wurde mangels Rohstoffen dann Zellwolle eingesetzt: 1936 wurden in Tuchen bereits bis zu 30 Prozent Ersatzstoffe verwendet.
Die Reißwolle war auch die Geschäftsgrundlage für den 1851 genehmigten Bau einer Zupfwollfabrik (Shoddyfabrik) am Hafen von Wittenberge (Elbe) neben der Ölmühle an der heutigen Bad Wilsnacker Straße. Der aus England stammende Fabrikant und Kaufmann James Dodgshun verarbeitete hier Lumpen aus Wolle zu Vorprodukten für die Wollgarn-Hersteller, nutzte dabei den Wasserweg auch für den Export. 1858 übernahm Joseph Naylor die Fabrik von seinem Schwager Dodgshun und erweiterte sie bis 1878 mit Spinnmaschinen und Webstühlen zu einer Volltuchfabrik für Damen- und Herrenstoffe.
1890 waren in der Wittenbergischen Wolle- und Tuchfabrik Naylor & Co. 300 Menschen beschäftigt, 1910 waren es sogar 700 Beschäftigte. Seit 1911 gehörte die Fabrik in Wittenberge zur Vereinigte Märkische Tuchfabriken AG und stellte 1931 wegen hoher Verluste ihren Betrieb ein. Anschließend wurden die Gebäude weitgehend abgebrochen und es entstanden dort Neubauten für die Norddeutsche Maschinenfabrik GmbH (Nordeuma), einen Hersteller unter anderem von Maschinengewehren für Flugzeuge. Seit 1885 hatte es in der Nähe einige Zeit eine zweite Shoddy-Fabrik gegeben: die Firma Gänicke & Becker KG.
Zellwolle und Zellulose aus Wittenberge
Wegen der Autarkiebestrebungen und des Rohstoffmangels im „Dritten Reich“ wurden in Deutschland in den 1930er Jahren Kunstfasern auf Basis von Naturstoffen und schließlich auch synthetische Fasern entwickelt. Konkret beschlossen die Nationalsozialisten im Rahmen eines Vier-Jahres-Plans 1935 das Nationale Faserstoff-Programm. Auf dieser Grundlage wurden in Deutschland in kurzer Zeit einige riesige Fabriken gebaut, welche sie herstellten. Dazu zählt die Kurmärkische Zellwolle und Zellulose AG in Wittenberge (Elbe), welche Mitte 1939 ihre Produktion aufnahm. Sie war Teil der etwa gleichzeitig von mehreren Werken gegründeten Phrix Zellwolle Verkaufsgemeinschaft. Wittenberge war das erste Werk, welches aus Stroh Zellulose gewann, um dies für die Herstellung von Zellwolle zu nutzen. Die Zellulose wurde in der Papier- und Chemieindustrie gebraucht, aber eben auch für die Produktion von Zellwolle, die als Surrogat in Wolltextilien diente.
Das Werk war seit 1938 auf einem in der Elbniederung neu aufgeschütteten Industriegebiet zwischen der Stepenitz und der Karthane gebaut worden. Über die hier zu einem Hafenbecken ausgebaute Karthane ließen sich Rohstoffe und Produkte verschiffen. Die erste Zellwolle stellte das Werk am 3. August 1939 her und bezog dafür fremden Zellstoff. Denn die eigene Zellstoffproduktion begann erst am 13. Mai 1940. Doch auch dieser Zellstoff wurde zu 98 Prozent an die Papierindustrie verkauft, weil seine Qualität für die Zellwolle nicht geeignet war. Wegen des Mangels an Rohstoffen und Beschäftigten schwankte die Produktion im Zweiten Weltkrieg dann stark. Im September 1944 waren im Werk 4450 Menschen beschäftigt, darunter sehr viele ausländische Zwangsarbeiter, seit 1942 auch Kriegsgefangene und Häftlinge aus Konzentrationslagern.
Nach dem Krieg arbeitete das Werk als VEB Zellstoff- und Zellwollewerke Wittenberge weiter, firmierte seit 1990 als Prignitzer Zellstoff- und Zellwollewerke GmbH Wittenberge. Von der Anlage blieb nur wenig erhalten, unter anderem die 1982 eingeweihte Kantine. Sie ist heute ein Baudenkmal mit der Gastronomie „Alte Zellwolle“.
Hanf aus dem Havelländischen Luch
Einen ganz anderen Strang der Textilfaserproduktion bediente die Hanffabrik Bergerdamm westlich von Nauen direkt am Großen Havelländischen Hauptkanal. Hanf war, ähnlich wie Flachs (Leinen), einst eine in Europa stark verbreitete Textilfaserpflanze. Doch in beiden Fällen müssen die Fasern relativ aufwendig von den übrigen Pflanzenbestandteilen getrennt werden, während die Baumwolle nahezu spinnfähig vom Strauch gepflückt werden kann. Mit dem sich während der Industrialisierung entwickelnden Transportwesen verdrängte die Baumwolle den Flachs und den Hanf. Letztere wurden aber in Nischen weiter angebaut.
Ein Durchbruch mit Hanf gelang dem Ingenieur Arthur Schurig (1869–1932). Der aus Paretz bei Ketzin stammende Schurig hatte 1908 im Luch die Staatsdomäne Hertefeld gekauft und krempelte hier nun die Landwirtschaft um, indem er Abläufe verbesserte und neuartige Maschinen einsetzte. So fuhr hier unter anderem 1924 der erste Mähdrescher Deutschlands. Im Ersten Weltkrieg ließ Schurig auf fast all seinen Flächen Hanf statt Weizen anbauen und versorgte so die Fabrik in Bergerdamm, welche die Pflanzen zu spinnfähigen Textilfasern verarbeitete. Nach dem Krieg kaufte Schurig die Fabrik der Deutschen Hanfbau-Gesellschaft ab, um das Geschäft zu intensivieren. Denn mit dem Hanf sollte der Ausfall des bis dahin aus der Kolonie Deutsch-Ostafrika kommenden Sisals kompensiert werden. In den 1920er Jahren arbeiteten etwa 250 Menschen in der Fabrik, damals der größte Hanfproduzent der Republik.
Für eine leistungsfähige Landwirtschaft war das Luch bereits von 1718 bis 1725 mit Kanälen durchzogen und so trockengelegt worden. Doch der spätere Verfall der wasserwirtschaftlichen Anlagen, die sowohl der Ent- wie auch der Bewässerung dienten, machte eine weitere Melioration mit dem Neubau von Kanälen, Dämmen, Brücken, Schleusen und Schöpfwerken notwendig: von 1897 bis 1900 und dann in einem zweiten Schritt von 1908 bis 1924. Im Ersten Weltkrieg arbeiteten geschätzt etwa 5000 Kriegsgefangene hier bei der Melioration und im Hanfanbau. Damals entstand auch ein etwa 70 Kilometer langes Feldbahnnetz sowie ein normalspuriges Anschlussgleis zum Bahnhof Bergerdamm an der Berlin-Hamburger Eisenbahn, um Material und Arbeiter zu transportieren. Seit etwa 1920 ließ Schurig so pro Jahr auch etwa 60000 Tonnen Berliner Hausmüll als Dünger in das Luch bringen, dort mehrere Jahre rotten und dann auf die landwirtschaftlichen Flächen verteilen. Vor allem beim Hanf und bei Zuckerrüben erbrachte der Müll einen erheblichen Mehrertrag. Ansonsten baute Schurig im großen Stil vor allem Gemüse für die Berliner an.
1973 endeten der Hanfanbau und die Verarbeitung im Luch. Die Hanffabrik wurde in den VEB Plakotex (Fehrbellin) eingegliedert und auf die Verarbeitung von Kunststoff zu Planen und Zelten umgestellt. 1992 wurde sie stillgelegt, 2004 dann abgerissen. Die benachbarte Siedlung aus der Entstehungszeit aber erinnert bis heute an diese Geschichte.
Fehrbellin und Rhinow liefern Hanf und Flachs
Der im Luch angebaute Hanf war auch der wichtigste Rohstoff für die 1935 in Wuppertal von Textilfabrikanten gegründete Bastfaser GmbH. Im Zuge der nationalsozialistischen Autarkiepolitik forcierte sie den Einsatz von heimischen Rohstoffen und verarbeitete deshalb Bastfasern wie Hanf und Flachs zu Zelt- und Lkw-Planen, Fallschirmgurten und anderen strapazierfähigen Grobtextilien. Dafür nahm sie 1936/37 zwei Hanfrösten in der Luchstraße in Fehrbellin und an der heutigen Werner-Seelenbinder-Straße 17 in Rhinow in Betrieb.
1938 übernahm die Bastfaser GmbH zudem die Landwirtschaftliche Hanfanbau- und Verwertungsgenossenschaft Rhinluch in Fehrbellin. Schließlich verlegte das Unternehmen auch seinen Sitz 1940 zur Fabrik in Fehrbellin mitten in sein größtes Hanfanbaugebiet.
Woher der Flachs für die Röste in Fehrbellin kam und in welchen Mengen er hier zu Vorprodukten für Spinnereien verarbeitet wurde, ist unklar. In gewissem Umfang wurde Flachs beziehungsweise Leinen jedenfalls auch im Land Brandenburg angebaut.
Beide Standorte setzten seit etwa 1940 in erheblichem Umfang Inhaftierte aus dem Frauenzuchthaus Cottbus und dem Frauenjugendgefängnis Berlin-Lichtenberg bei der Arbeit ein, außerdem auch polnische Kriegsgefangene sowie niederländische und sowjetische Zwangsarbeiter. In der Röste in Fehrbellin waren 1944 etwa 700 Menschen beschäftigt, weit mehr als die Hälfte Frauen, die im dortigen „Arbeitserziehungslager“ festgehalten wurden. Für sie soll dieses Straflager ähnlich hart gewesen sein wie ein Konzentrationslager. Außerdem wurden Hausfrauen aus der Region als Hilfsarbeiterinnen beschäftigt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Bastfaser GmbH mit dem Werk in Fehrbellin verstaatlicht und zum VEB Märkische Bastfaser. Später firmierte der Betrieb als VEB Plakotex (Abkürzung für: Plastbeschichtung und Konfektion technischer Textilien), zu der dann auch die Hanffabrik Bergerdamm gehörte. Nach der deutschen Wiedervereinigung wurde aus der Plakotex die Newtex GmbH.
Kunst- und Synthesefasern aus Premnitz
Schließlich ließ das „Dritte Reich“ Kunstfasern entwickeln. Dabei ging es zunächst vor allem um die Produktion von Viskose. Sie wurde auf Basis von Zellulose hergestellt und diente als Ersatz für Baumwolle. Für die Viskose-Produktion entstand eine Reihe neuer Fabriken, da die Kapazitäten der bestehenden Unternehmen Vereinigte Glanzstoff-Fabriken AG und IG Farbenindustrie AG (dazu gehörte auch das Werk in Premnitz) nicht ausreichten. In diesem Rahmen neu gegründet wurden damals die Thüringische Zellwolle AG, die Phrix AG (mit dem Werk Wittenberge) sowie eine Reihe kleinerer Firmen. Außer Kunstfasern, bei denen natürliche Rohstoffe chemisch umgewandelt wurden, arbeiteten die Unternehmen auch an künstlich hergestellten (voll-)synthetischen Fasern. Letztere bildeten eine wichtige Grundlage für das zu DDR-Zeiten betriebene Chemiefaserwerk Premnitz.
Das Werk ging auf eine im Ersten Weltkrieg eingerichtete Fabrik für Schießwolle auf der Basis von Nadelholz-Zellstoff zurück. 1915 hatten die Vereinigten Köln-Rottweiler Pulverfabriken AG mit dem Bau begonnen: Im April 1916 ging der erste Teil in Betrieb. Anfang 1918 waren im Werk 5130 Menschen beschäftigt. Mit dem Ende des Krieges stellte sich der Betrieb rasch auf eine zivile Produktion um: 1919 begann hier die Entwicklung von Kunstfasern auf Zellulose-Basis. Ein Jahr später stellte das Werk dann zum ersten Mal die Viskose-Spinnfaser „Vistra“ her, die erste Zellwolle der Welt und „das weiße Gold Deutschlands“. 1924 folgte eine kleine Anlage für Travis-Kunstseide (Filamentgarn aus Viskose). Und 1925 beschäftigte das Werk (seit 1926 Teil der IG Farben) schon wieder 1830 Mitarbeiter. 1931 begann hier die Produktion eines zweiten Sortiments für Kunstseide mit den Typen Mattseide Suprema und Glanzseide Trinova.
Unterdessen gelang Emil Hubert im Labor des Werks Wolfen das Erspinnen der ersten vollsynthetischen Faser der Welt: Die Pe-Ce-Faser bestand aus Polyvinylchlorid (PVC). Sie war seit 1928 auch in Premnitz mitentwickelt worden. 1938 ging die Faser in die Großproduktion – doch das Interesse daran war damals noch gering. Etwa zur selben Zeit entwickelten Dupont in den USA seit 1927 und die IG Farben in Deutschland seit 1926 zudem die Polyamid-Fasern Nylon und Perlon. Mehrere Werke der IG Farben arbeiteten daran, doch in einem Labor in Premnitz wurde die später heiß begehrte Faser in der Nacht zum 29. Januar 1938 erstmals erzeugt.
Noch 1938 brachten IG Farben wie auch Dupont Perlon und Nylon in geringen Mengen auf den Markt: für Damenstrümpfe und Borsten. Im Mai 1939 tauschten beide Konzerne dann ihre Patente für die Polyamid-Fasern aus und bestimmen ihre weltweiten Absatzmärkte für die „synthetische Seide“. Im Detail verschieden, sind diese Polyamid-Fasern praktisch kaum zu unterscheiden. Das Werk Premnitz, das damals mehr als 4000 Beschäftigte hatte, nahm noch 1944 eine Versuchsanlage für die Großserienproduktion in Betrieb.
Diese Produktbasis aus Viskose sowie PVC und Perlon baute das Kunstseidenwerk „Friedrich Engels“ VEB Premnitz, trotz Demontagen der Sowjets, nach dem Zweiten Weltkrieg erheblich aus. Schon 1948 beschäftigte das Werk wieder 3400 Menschen. Und es baute bis 1954 eine ganz neue Viskose-Produktion für Kunstseide (Marke „Prezenta“, später auch „Regan“) auf, erzeugte ab 1951 dann großtechnisch Stapelfasern aus Polyamid (Perlon).
1958 beschloss die DDR in Leuna unter dem Motto „Chemie gibt Brot – Wohlstand – Schönheit“ vor dem Hintergrund der weltweit aufstrebenden Erdölchemie ihr Chemieprogramm. Allerdings musste das Land seine Perlonfaser auf Druck des Westens umbenennen: Ab 1959 wurde dafür das Warenzeichen Dederon benutzt und mit einer breiten Werbekampagne eingeführt. Der auf das Kürzel des jungen Staates abhebende Name De-De-Ron sollte ebenso wie Slogans „Dederon aus der DDR in alle Welt“ und „Der Faden vollendeter Verlässlichkeit“ die Überlegenheit des Landes assoziieren. Dederon war nicht nur in den unverwüstlichen Kittelschürzen, sondern vor allem in Mischungen mit Naturfasern der Oberbekleidung sowie in Strick- und Strumpfwaren zu finden. Außerdem wurde Dederon in Dekorations- und Möbelstoffen, Teppichen, Zelten, Filtern und Filzen eingesetzt.
Statt Kunstfasern stellte die Fabrik immer mehr synthetische Fasern her und firmierte deshalb seit 1960 als VEB Chemiefaserwerk „Friedrich Engels“. Gleichzeitig begann nach erheblicher Vorarbeit die Herstellung der Polyacrylnitril-Faser. Sie war schon seit 1955 auch in Wolfen hergestellt worden, wurde zunächst als „Wolcrylon“ oder „Prelana“ bezeichnet, ehe der Markenname seit 1961 auf Wolpryla vereinheitlicht wurde. Die Faser hatte wollähnliche Eigenschaften und wurde auch als „wolliges Wunder der Chemie“ bezeichnet. Laut Werbung hatte Wolpryla das gleiche Warmhaltevermögen, war aber leichter als Wolle, bei der Weiterverarbeitung und der Pflege besser zu handhaben und filzte nicht. Außerdem war sie preiswerter, so dass Stricken in Privathaushalten ein Revival erlebte. Es gab Werbesprüche wie „Wolcrylon ist unverwüstlich“ und „Plastische Maschen sind modern“. Wolpryla wurde vor allem für Ober- und Untertrikotagen, Bade- und Freizeitbekleidung, Jersey- und Druckstoffe, Kleider- und Anzugstoffe sowie Decken und Handstrickgarne verarbeitet. Außerdem diente Wolpryla als Füllmaterial für Steppdecken und Schlafsäcke.
1972 folgte die großtechnische Herstellung von Polyester-Stapelfasern unter der Marke Grisuten (vorher „Lanon“ genannt). Grisuten hatte ähnliche Gebrauchseigenschaften wie Dederon. Es knitterte wenig, war elastisch und wurde als sehr formbeständig angepriesen. Außerdem konnte Grisuten mühelos gereinigt und musste nicht gebügelt werden. Damit eignete es sich zur Herstellung von pflegeleichten Blusen und Hemden, Kleidern, Anzug-, Kostüm- und Rockstoffen, Regenmänteln und Badebekleidung, Tisch- und Bettwäsche, Gardinen und Dekorationsstoffen. Außerdem wurden Filter, Planen und – für die Medizin – künstliche Arterien aus Grisuten hergestellt. Vielfach bekannt sind die unter dem Namen „Präsent 20“ – zum 20jährigen Bestehen der DDR – damit geschneiderten Anzüge und Kleider.
Die Fasern Regan, Dederon, Wolpryla und Grisuten blieben bis zum Ende der DDR in verbesserten Qualitäten die Schwerpunkte der Premnitzer Produktion. Nach der deutschen Vereinigung firmierte das Werk zur Märkischen Faser AG um. Einige Teile wurden verkauft, andere schrittweise geschlossen, im Jahr 2000 der Wolpryla-Betrieb und 2003 die Kunstseiden-Produktion. Doch die Grisuten-Anlage führt die Märkische Faser GmbH bis heute weiter.
Lumpen und Zellulose für das Papier aus Hohenofen
Der klassische – und qualitativ hochwertigere – Rohstoff für die Papierproduktion sind Lumpen (auch Hadern genannt) aus Pflanzenstoffen: vor allem Baumwolle, Hanf und Leinen (Flachs). Sie werden geschnitten, unter Zugabe von Kalk und Soda gekocht und so für die Papierherstellung aufgeschlossen. Anschließend wird dieser Halbstoff in unterschiedlichen Verfahren gemahlen und damit der Charakter des Papiers bestimmt. Wird die Faser bei der röschen (raschen) Mahlung zwecks guter Blattbildung nur gekürzt, bleibt also in ihrer schlauchförmigen Struktur erhalten, lässt sich damit im Extremfall gut Löschpapier herstellen. Wird aber die Faser bei einer langen und schmierigen Mahlung zerstört, entsteht der für Transparentzeichenpapier notwendige Stoff. Dem Ganzstoff werden außerdem Hilfsstoffe beigemengt, um bestimmte Eigenschaften zu erzielen: Füllstoffe wie Kaolin oder Kreide, Bindemittel wie Leim, außerdem Farben und andere Chemikalien.
Die 1838 gegründete Patent-Papierfabrik Hohenofen verarbeitete lange Zeit nur Hadern, die von Lumpensammlern aus der Region angeliefert wurden. 1906 erhöhte die Fabrik ihre Produktion noch einmal erheblich und nahm dafür auch ein neues Lumpenhaus in Betrieb. Hier lagerten im Erdgeschoss die angelieferten Lumpen, in der mittleren Etage wurden sie sortiert und in der oberen Etage sortenrein eingelagert. Über die heute noch vorhandene Lorenbrücke wurden die Lumpen dann zum Hadernboden in das Hauptgebäude gegenüber transportiert, bevor sie dort gekocht und vermahlen wurden.
Seit 1889 verarbeitete das Werk – zunächst in geringem Umfang – auch Zellstoff. Denn Lumpen waren knapp und damit teuer, ihr Transport und ihre Aufbereitung aufwendig. Zellstoff ist einfacher zu handhaben. Für das ab 1967 ausschließlich in Hohenofen hergestellte Transparentzeichenpapier wurde statt Lumpen nur noch Zellstoff verwendet, der aus Blankenstein (Saale) in Thüringen, später auch aus Skandinavien bezogen wurde. 1990 weitgehend stillgelegt, ist die Papierfabrik heute ein herausragendes Technisches Denkmal.
Autor:
Sven Bardua
Industriearchäologe und Redakteur
Brombeerweg 43, 22339 Hamburg, Tel. 040 / 430 16 76